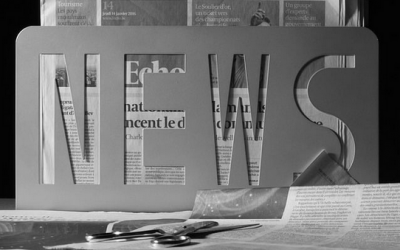Das Digitalfunk-Projekt der Bundeswehr entwickelt sich immer mehr zum Symbol deutscher Rüstungsbürokratie im Ausnahmezustand. Seit Jahren scheitert das Heer daran, funktionsfähige digitale Funkgeräte in seine Fahrzeuge einzubauen – ein Vorhaben, das eigentlich längst Standard sein müsste. Statt Fortschritt gibt es neue Verzögerungen, technische Pannen und millionenschwere Beraterverträge.
Während Soldaten weiter mit veralteter analoger Technik funken müssen, sollen nun Capgemini, PwC und Co. für knapp 160 Millionen Euro die Lage retten. Tagessätze von über 1200 Euro pro Kopf – ein Preis, der nach Verzweiflung klingt, nicht nach Effizienz.
Die Realität: Der Einbau der Funkgeräte zieht sich wie Kaugummi. In manchen Fällen kostet ein einzelner Umbau 400 Arbeitsstunden – pro Fahrzeug. Gleichzeitig kämpft die Software, entwickelt unter anderem von einer Rheinmetall-Tochter, mit eigenen Problemen. Dass die NATO-Truppe „Division 2025“ nun wohl erst 2027 voll einsatzbereit sein wird, überrascht kaum noch jemanden.
Anstatt das strukturelle Chaos zu beseitigen, wird weiter Geld in Beraterkreise gepumpt, die längst Teil des Problems geworden sind. Wenn der Staat zur eigenen Modernisierung externe Hilfe für Millionen braucht, läuft etwas grundsätzlich falsch.
Der Digitalfunk der Bundeswehr steht damit sinnbildlich für ein System, das lieber Konzepte schreibt, als Lösungen umzusetzen. Und während in Berlin noch über Mischbetrieb und Zwischenlösungen diskutiert wird, bleibt an der Front eines gleich: Funkstille.
Andere relevante Artikel in den Fremdmedien:
heise+: Digitalfunk-Desaster der Bundeswehr: Millionen für Berater sollen es richten